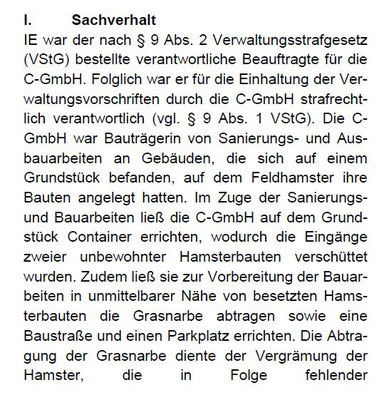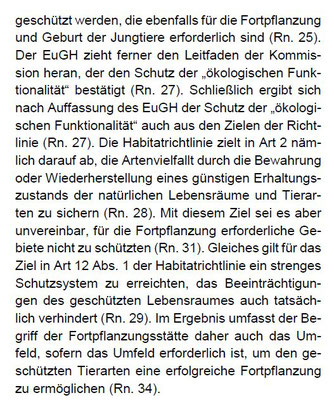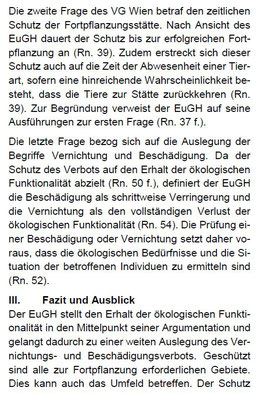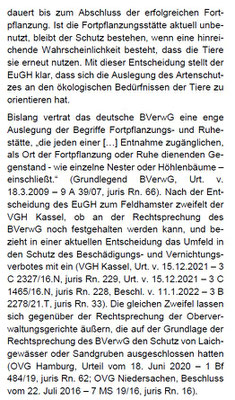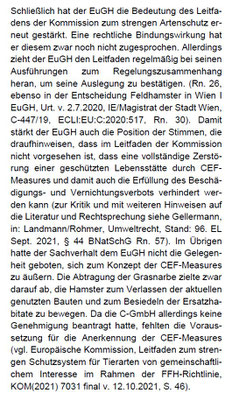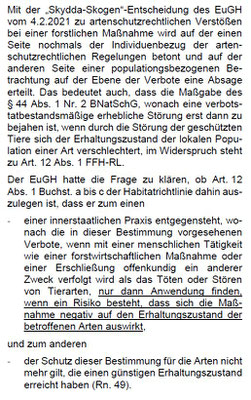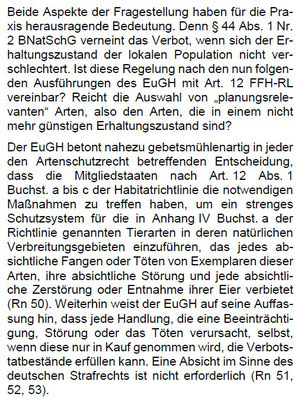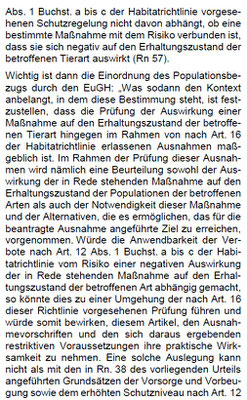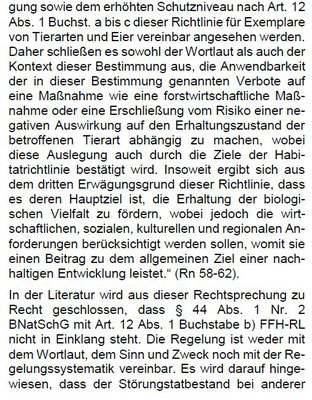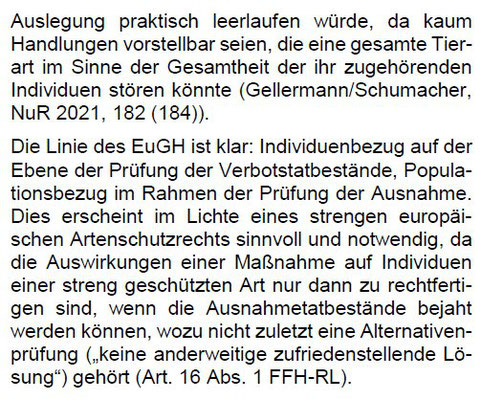EugH urteilt entgegen deutsche Praxis zu Fortpflanzungsstätten und Individuenschutz
Zwei Urteile des EuGH aus dem Jahr 2021 sollten Eingang in den Verlauf von Bauleitplanverfahren finden, denn sie widersprechen der deutschen Praxis zur Ermöglichung von Bauflächen wider den Lebensräumen.
EuGH 28.10.2021: weite Auslegung des Vernichtungs- und Beschädigungsverbot, Erhalt ökologische Funktion Umfeld Fortpflanzungsstätten
LNV: Ökologische Bedürfnisse der Tierarten sind zu berücksichtigen
Der EuGH stellt in seinem Urteil v. 28.10.2021, Rs. C-357/20 den Erhalt der ökologischen Funktionalität in den Mittelpunkt seiner Argumentation und gelangt dadurch zu einer weiten Auslegung des Vernichtungs- und Beschädigungsverbots. Geschützt sind alle zur Fortpflanzung erforderlichen Gebiete. Dies kann auch das Umfeld einer Fortpflanzungsstätte betreffen. Der Schutz dauert bis zum Abschluss der erfolgreichen Fortpflanzung. Ist die Fortpflanzungsstätte aktuell unbenutzt, bleibt der Schutz bestehen, wenn eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Tiere sie erneut nutzen. Mit dieser Entscheidung stellt der EuGH klar, dass sich die Auslegung des Artenschutzes an den ökologischen Bedürfnissen der Tiere zu orientieren hat.
Der EuGH urteilte zu einem konkreten Fall mit Störung des Umfelds von Feldhamstern, dass mit dem Beschädigungs- und Vernichtungsverbot von Lebensräumen und dem Gebot Bewahrung/ Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungstandes der natürlichen Lebensräume das Gebot des Erhalts der ökologischen Funktion des Umfeldes einer Fortpflanzungssätte folgt.
Damit ist die in Umweltgutachten verwendete Begründung einer Zerstörung "Das sind nur potentielle Fortpflanzungsstätten" nicht mehr haltbar. Die deutsche Praxis gewährt den Schutz von Flächen für Feldlerchen erst dann, wenn sie dort herumzwitschern und genau dort auch brüten.
Mit diesem EuGH-Urteil gilt somit ein viel weiteres Vernichtungs- und Beschädigungsverbot als die für Bauvorhaben praktische enge Auslegung des Naturschutzgesetzes. Es gilt ein bleibender Schutz von Fortpflanzungsstätten, wenn deren erneute Nutzung Wahrscheinlich ist. Die ökologischen Funktion des Umfeldes muss erhalten bleiben. Dies ist unabhängig von stichprobenartigen Erfassungen beispielsweise der Feldlerche.
Mit EuGH-Urteil 4.2.2021 gilt bereits Schutz des Individuums. Nach EU-Recht sind somit auch Arten mit günstigem Erhaltungszustand geschützt.
LNV: Populationsbezug nur im Rahmen der artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung
Ein schwedischer Fall veranlasste den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu einigen Klarstellungen betreffs der Auslegung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände (Urteil vom 4.3.2021). Mit der "Skydda-Skogen"-Entscheidung wird der Individuenbezug der artenschutzrechtlichen Regelungen betont und einer populationsbezogenen Betrachtung auf der Ebene der Verbote eine Absage erteilt. Daraus ergibt sich lt. Informationsdienst Umweltrecht (IDUR): § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, der einen Bezug zum Erhaltungszustand der lokalen Population als Voraussetzung für die Störung normiert, ist europarechtswidrig
Der EuGH nahm die Habitatrichtlinie, Art 12 Abs 1 Buchst a bis c zur Hand leitete daraus den Individuenbezug ab. Denn Handlungen betreffend "Exemplare" und "Eier" sind verboten. Würde nur auf den Erhaltungszustand der Art geschaut werden, würde das die Rechtsnorm schwächen.
In der Praxis wird von den Behörden (Landratsamt, Regierungspräsdium) eine Vergrämungsmaßnahme in eine Schutzmaßnahme verdreht, damit eventuell brütende
Feldlerchen nicht durch archäologische Grabungsarbeiten gestört werden und so ein Verbotstatbestand nach §44 BNatschG ausgelöst werden würde
§44 Bundesnaturschutzgesetz definiert Verbote im Umgang mit besonders und streng geschützten Arten und deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Natürlich enthält er
auch Ausnahmen, damit die Verbote nicht greifen.
Ziel Biodiversität auf unterstem Niveau verfolgt. (Siehe Irrtum Beschränkung auf streng geschützte Arten)
Also: Feldlerche genießt als nur „besonders geschützte Art“ nicht den Schutz der „streng geschützten“ Arten nur während Fortpflanzungszeit nicht zu stören.
Auf Population sei nicht zu achten (es gäbe ja noch genug), Feldlerchenfenster in Nachbarschaft würden genügen
Mit EuGH-Urteil vom 4.2.2021 sind Arten auch mit günstigem Erhaltungszustand geschützt, da das Gesetz den Schutz des Individuums vorsieht. Entgegen deutscher Praxis muss man nicht warten, bis Arten auf einer Gefährdungsliste stehen. Die übliche populationsbezogene Betrachtung mit der Aussage, in der Region gäbe es noch genügend Brutpaare steht im Widerspruch zum EuGH.